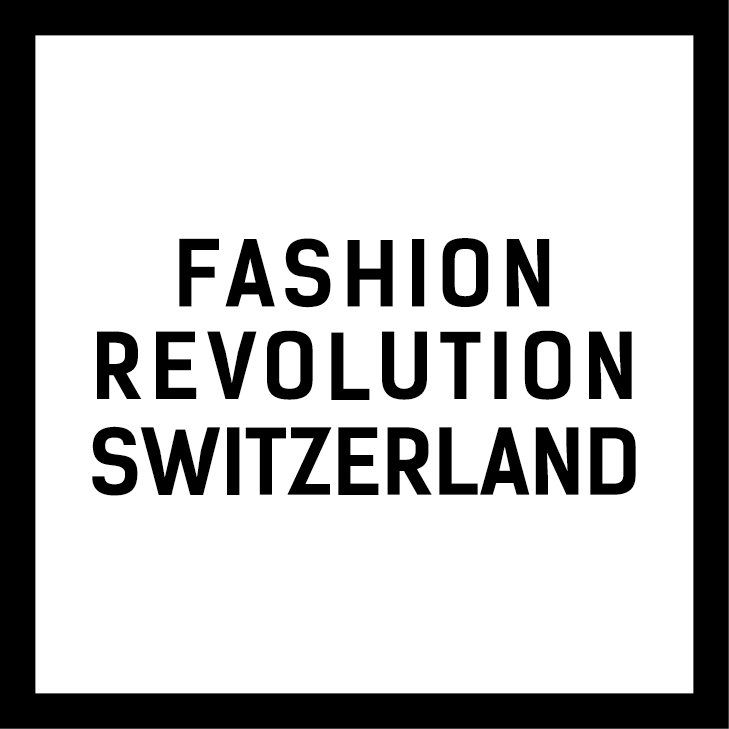Warum wir kaufen, obwohl wir’s besser wissen: Ein Gespräch über Überkonsum und die Psychologie hinter dem Black Friday
Nicole Haiderer, Umwelt- und Wirtschaftspsychologin
Warum greifen wir zu, obwohl wir längst wissen, dass wir genug haben? Hinter unserem Konsumverhalten stecken starke psychologische Mechanismen: von Gewohnheiten über Emotionen bis hin zu cleverem Marketing.
Um besser zu verstehen, was dabei in uns passiert und wie wir nachhaltigere Entscheidungen treffen können, haben wir mit Nicole Haiderer, Umwelt- und Wirtschaftspsychologin, gesprochen. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen zu nachhaltigem Verhalten motiviert werden können und welche psychologischen Mechanismen dabei eine Rolle spielen. Mit Keen Minds berät sie Organisationen und entwickelt Workshops und Trainings zu Klimakommunikation und Verhaltensänderung (Behavioural Design).
Black Friday gilt als Symbol des modernen Konsums Rausches. Warum fällt es uns so schwer, solchen Rabattaktionen zu widerstehen?
Die Werbebranche bedient sich zahlreicher psychologischer Methoden, um den Verkauf zu steigern. Am Black Friday wird besonders deutlich, wie wirkungsvoll und vielfältig diese Strategien sind. Aus psychologischer Sicht greifen an diesem Tag gleich mehrere Mechanismen ineinander und genau das macht Rabattaktionen so verführerisch.
Wenn ein Produkt statt 300 plötzlich 200 Franken kostet, empfinden wir das als „Gewinn“. Selbst wenn wir es zum ursprünglichen Preis nie gekauft hätten. Der Referenzpunkt verschiebt sich, und wir bewerten das Angebot plötzlich anders. Rational betrachtet ist das kein echter Gewinn, emotional aber sehr wohl.
Ein weiterer Faktor ist die künstliche Knappheit. Botschaften wie „nur heute“ oder „solange Vorrat reicht“ aktivieren unser Stresssystem und setzen uns unter Druck. Unter Zeitdruck greifen wir häufiger zu impulsiven Entscheidungen. Wir verlieren einen Teil unserer Selbstkontrolle und reagieren automatisch.
Auch die emotionale Inszenierung spielt eine grosse Rolle. Signalfarben wie Rot, Prozentzeichen oder Countdown-Timer sprechen unser Belohnungssystem direkt an. In diesem Zustand arbeitet unser Gehirn im Schnellmodus, wir reagieren emotional statt überlegt.
Und dann kommt noch der soziale Faktor hinzu. Black Friday ist ein kollektives Ereignis. Alle sprechen darüber, überall sieht man Werbung oder Posts mit neuen Einkäufen. Wenn unser Umfeld signalisiert, dass „man jetzt einkauft“, verstärkt das den inneren Druck, mitzumachen.
All diese Mechanismen zusammen bilden einen perfekten Sturm für unser Belohnungssystem und erklären, warum selbst Menschen, die sich als reflektiert oder konsumkritisch sehen, an diesem Tag oft schwach werden.
Viele Menschen wissen eigentlich, dass sie nicht wirklich etwas brauchen und kaufen trotzdem. Wie erklärst Du diesen Widerspruch zwischen rationalem Wissen und emotionalem Handeln?
Das lässt sich sehr gut mit den Erkenntnissen von Daniel Kahneman und Amos Tversky erklären. Sie beschreiben unser Denken als Zusammenspiel von zwei Systemen. Das eine arbeitet langsam, überlegt und rational, das andere schnell, intuitiv und impulsiv.
Das langsame System kann logisch abwägen: „Ich habe genug“, „Das ist nur ein Rabatt-Trick", „Ich spare eigentlich kein Geld, wenn ich mehr ausgebe.“ Dieses System braucht jedoch Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Diese Ressourcen sind im Alltag oft knapp.
Das schnelle System reagiert dagegen unmittelbar auf Reize. Es lässt sich von allem ansprechen, was emotional wirkt: Belohnungsversprechen, Knappheitssignale, Farben, Storytelling oder soziale Normen. Und genau darauf zielt die Werbung.
Warum gewinnt also das schnelle System so oft?
Zum einen, weil Rabatte unser Belohnungssystem aktivieren. Es wird Dopamin ausgeschüttet, was ein Gefühl von Vorfreude und Belohnung erzeugt. Das rationale System wirkt daneben eher blass und unemotional, es braucht bewusste Selbstkontrolle, um dagegenzuhalten.
Zudem sind emotionale Trigger schlicht schneller als bewusste Überlegungen. Wenn wir Knappheit oder Zeitdruck wahrnehmen, schaltet unser Körper in den Modus „schnell entscheiden“. Der Teil des Gehirns, der für Planung und Selbstkontrolle zuständig ist, arbeitet dann weniger gut.
Und schliesslich erfüllt Konsum oft auch emotionale oder soziale Bedürfnisse. Viele Menschen kaufen nicht, weil sie etwas brauchen, sondern weil sie sich gestresst fühlen, sich belohnen möchten, ihr Selbstwertgefühl stärken oder einfach dazugehören wollen. Kaufen vermittelt ein Gefühl von Kontrolle, zumindest kurzfristig.
Viele wissen auch, dass Fast Fashion Umwelt und Menschen schadet, konsumieren aber dann doch Fast Fashion. Warum handeln wir oft gegen unser besseres Wissen?
In solchen Momenten stehen andere Bedürfnisse im Vordergrund. Kurzfristige Belohnungen übertrumpfen langfristige Konsequenzen. Die Umweltschäden und die Arbeitsbedingungen liegen weit weg, räumlich, zeitlich und emotional. Der schnelle Kick eines schönen Outfits ist dagegen sofort da. Unser Gehirn bevorzugt naturgemäss unmittelbare Belohnungen. Dieses Prinzip nennt man Instant Gratification.
Dazu kommen strukturelle Anreize, die nachhaltiges Verhalten erschweren. Fast Fashion ist günstig, jederzeit verfügbar und einfach zugänglich. Nachhaltige Alternativen sind oft teurer, aufwendiger zu finden oder weniger präsent. Der Kontext belohnt also das eine Verhalten und erschwert das andere. Wissen allein reicht nicht aus, um diese Hürden zu überwinden.
Im Endeffekt profitiert niemand davon. Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen am Black Friday zwar kurzfristig höhere Umsätze erzielen, sich das über das Jahr betrachtet aber ausgleichen. Sie sind aber unter Zugzwang, da die überwiegende Mehrheit Rabatte anbietet. Das heisst, weder Konsument*innen noch Unternehmen gewinnen wirklich. Menschen haben am Ende weniger Geld auf dem Konto, Unternehmen mehr Aufwand, aber keinen zusätzlichen Gewinn. Und der Planet trägt die Konsequenzen. Besonders spannend finde ich Unternehmen, die sich klar gegen den Überkonsum positionieren und am Black Friday bewusst keine Rabatte anbieten. Sie senden damit ein wichtiges Signal.
Viele Menschen empfinden nach Black Friday-Käufen Schuld oder Leere. Was passiert da psychologisch, und wie kann man dieses Gefühl vermeiden?
Ich erlebe das nicht bei allen Menschen gleich. Manche empfinden tatsächlich Stolz, weil sie dem Kaufrausch widerstanden haben. Andere freuen sich über das vermeintliche Schnäppchen. Doch bei vielen tritt nach dem Kauf eine Art emotionaler Absturz auf, ein sogenannter Reward Crash.
Während des Kaufmoments ist das Belohnungssystem im Gehirn aktiv. Der Dopaminspiegel steigt, man spürt Vorfreude, Erregung und das gute Gefühl, etwas gewonnen zu haben. Nach dem Kauf fällt der Dopaminspiegel jedoch schnell wieder ab. Wenn der erwartete emotionale Kick ausbleibt oder nur sehr kurz anhält, entsteht eine Leere.
Dieses Loch füllen viele dann unbewusst mit Rechtfertigungen oder weiterem Konsum. Schuldgefühle entstehen vor allem dann, wenn das eigene Verhalten nicht mit den persönlichen Werten übereinstimmt, etwa mit dem Wunsch, nachhaltiger zu leben, oder wenn einem bewusst wird, dass man viel Geld für Produkte ausgegeben hat, die man gar nicht braucht. Um dieses Gefühl zu vermeiden, hilft es, sich schon vor dem Kauf klarzumachen, was man sich emotional erhofft. Geht es um Freude, Bestätigung oder Ablenkung? Diese Bedürfnisse lassen sich oft auch auf andere Weise erfüllen, zum Beispiel durch soziale Kontakte, Bewegung oder Kreativität. Wer weiss, wonach er oder sie eigentlich sucht, ist weniger anfällig für kurzfristige Belohnungsreize.
Was können wir als Konsument*innen tun, um uns von Konsum Reizen nicht manipulieren zu lassen und stattdessen eine gesunde, nachhaltige Beziehung zu Mode zu entwickeln?
Ich kann an meiner eigenen Selbstregulation arbeiten. Zum Beispiel, indem ich meine Kaufimpulse genauer beobachte. Ich frage mich: Welches Gefühl will ich gerade regulieren? Brauche ich das Produkt oder brauche ich eigentlich ein gutes Gefühl? Allein das Benennen des Gefühls reduziert den Impuls deutlich.
Ich kann auch die sogenannte Delay-Technik anwenden und 24 bis 48 Stunden warten. Impulskäufe verlieren fast immer ihren Reiz, sobald sich das Belohnungssystem wieder beruhigt hat. Hilfreich ist auch, die eigenen Trigger zu erkennen. Mode wird emotional verkauft. Wenn man weiss, was wirkt, etwa Rabatte, Knappheit oder Social Media, kann das die Wirkung bereits abschwächen. Bewusstheit ist einer der stärksten Hebel gegen Manipulation.
Ich mache es persönlich so, dass ich mir mit Kolleginnen gegenseitig Fotos von Kleidungsstücken schicke, die wir kaufen möchten. Das ehrliche Feedback der anderen ist ein wertvoller Realitätscheck. Dabei geht es nicht primär um die Frage, ob etwas nachhaltig ist oder nicht, sondern vielmehr um: Hast du so etwas schon? Ist es das Geld wirklich wert? Brauchst du das? Steht es dir? Oder ist der Trend nur kurzfristig?
Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Gestaltung des eigenen Umfelds. Nachhaltigkeit kann am Kontext scheitern. Ein einfacher Schritt ist, alle Shopping-Apps vom Handy zu löschen. Das Öffnen dieser Apps passiert oft unbewusst. Falls das schwerfällt, kann man stattdessen Secondhand-Apps installieren. Kein Kauf ist die beste Alternative, Secondhand die zweitbeste.
Oft ist mit dem Konsum von Kleidung auch der Wunsch verbunden, sich selbst neu zu erfinden. Mode ist ein Ausdruck von Identität, von Wandel und Selbstwirksamkeit. Dieses Bedürfnis ist vollkommen menschlich. Wir alle verändern uns, und Kleidung kann ein sichtbarer Teil dieser Entwicklung sein.
Anstatt diesen Impuls durch neue Käufe zu erfüllen, kann man ihn auch kreativ nutzen. Eine Möglichkeit ist, bewusst zum eigenen Kleiderschrank zu gehen und sich zu fragen, welche Kleidungsstücke man bereits hat und wie sie sich neu kombinieren lassen. Oft entstehen dabei ganz neue Looks, die man so noch nie getragen hat. Das kann denselben Effekt haben wie ein Neukauf, nur nachhaltiger.
Zu guter Letzt kann man die Pflege von Kleidung gar nicht genug betonen. Weniger waschen, Pflegehinweise beachten und auf gute Qualität achten, auch beim Secondhand-Kauf. Ein Pullover, der zur Hälfte aus synthetischem Material besteht, fusselt schneller und wirkt rasch abgetragen. Mein persönlicher Gamechanger war eine kleine Fusselrasiermaschine für Wollpullover. Gute Pflege und das regelmässige Entfernen von Fusseln verlängern die Lebensdauer von Kleidung deutlich und tragen dazu bei, dass man die eigenen Stücke länger gern trägt.
Finde Nicole auf Instagram.